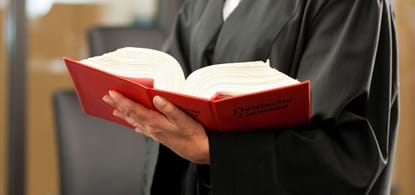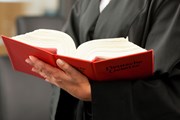+++ Täuschung durch Unterlassen und konkludente Täuschung +++ Garantenstellung aus Ingerenz +++ Computerbetrug, § 263a StGB +++ Betrugsäquivalente Auslegung +++
Sachverhalt (vereinfacht): T beantragte am 03.02.2007 im automatisierten Mahnverfahren einen Mahnbescheid über 10.000,- € gegen die A-GbR beim zuständigen Amtsgericht. Als Anspruchsgrund gab er an: „Dienstleistungsvertrag gem. Rechnung vom 02.11.2006". Dabei war ihm bewusst, dass ihm tatsächlich kein solcher Anspruch zusteht, weil ein entsprechender Vertrag zwischen ihm und der A-GbR nie geschlossen worden war. Entsprechend den Angaben des T wurde dieser Mahnbescheid seiner Mutter M, die gleichzeitig Gesellschafterin der A-GbR war, unter deren Wohnanschrift zugestellt. Abredegemäß legte M gegen den Mahnbescheid keinen Einspruch ein und informierte auch ihre Mitgesellschafter hiervon nicht. Auf die gleiche Weise erwirkte T in der Folge den entsprechenden Vollstreckungsbescheid. Aufgrund dessen betrieb T die Vollstreckung in das Vermögen der A-GbR, indem er eine Forderung der A-GbR gegen die B-Bank in Höhe von 11.000,- € auf seinen Antrag hin durch das Vollstreckungsgericht pfänden und sich überweisen ließ. Tatsächlich wurden von der B schließlich 11.000,- € auf das Konto des T überwiesen.
Strafbarkeit des T nach §§ 263 ff. StGB?
A) Sounds
1. Die Beantragung eines Mahn- und Vollstreckungsbescheids im automatisierten Mahnverfahren auf Grundlage einer fingierten, tatsächlich nicht bestehenden Forderung stellt eine Verwendung unrichtiger Daten im Sinne des § 263a I Var. 2 StGB dar.
2. Der Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses nach Titulierung einer nicht bestehenden Forderung im Mahnverfahren begründet keine konkludente Täuschung. Für die Annahme einer Täuschung durch Unterlassen fehlt es regelmäßig an der notwendigen Garantenstellung, weil Ingerenz ausscheidet.
B) Problemaufriss
Es ist jedem Examenskandidaten zu empfehlen, sich mit dieser Entscheidung des BGH zu beschäftigen. Nicht nur, dass sie eine Vielzahl von Problemen des sehr examensrelevanten Betrugstatbestands enthält und diese mit solchen des Allgemeinen Teils kombiniert, betrifft sie darüber hinaus einen Schnittbereich zwischen Strafrecht und Zivilprozessrecht. Die Tatsache, dass zur sachgemäßen Bearbeitung des -- sachverhaltsmäßig leicht zu erfassenden -- Falles zumindest Grundkenntnisse der §§ 688 ff. ZPO erforderlich sind, macht die besondere Eignung der Entscheidung für Klausuren und insbesondere Examensarbeiten aus.
Bei der Anwendung des § 263 StGB und des § 263a StGB gilt es Differenzierungsvermögen zu beweisen. Der Betrug knüpft an den Antrag des Erlasses eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses an, weil das Verfahren bis zu diesem Zeitpunkt rein automatisiert ablief. In diesem Rahmen stellt sich die Frage, ob eine Täuschung angenommen werden kann, wenn die Vollstreckung aus einem Titel -- in Form eines Vollstreckungsbescheids -- betrieben werden soll, den sich der Vollstreckungsgläubiger zuvor unter Ausnutzung der Besonderheiten des Mahnverfahrens erschlichen hat. Dabei ist besonders die Unterscheidung von Täuschung durch aktives Tun und Täuschung durch Unterlassen zu berücksichtigen. Letztere Rechtsfigur erfordert eine Auseinandersetzung mit dem Problem der Reichweite der Ingerenzgarantenstellung des Täters, anknüpfend an die Durchführung des Mahnverfahrens.
Der Computerbetrug dagegen könnte schon im Vorfeld an dem Mahnantrag und der Einleitung des automatisierten Verfahrens festgemacht werden. Es stellt sich das hinsichtlich § 263a I Var. 3 StGB bekannte Problem der betrugsnahen Auslegung des § 263a StGB, wobei auch hier die Besonderheiten des Mahnverfahrens zu berücksichtigen sind. Auch die Feststellung des Vermögensschadens bedarf angesichts der Restriktionstendenzen der neueren Rechtsprechung einer präzisen Untersuchung.
C) Lösung
Zu prüfen ist die Strafbarkeit des T gem. §§ 263 ff. StGB.
I. Antrag auf Erlass eines Mahn- und eines Vollstreckungsbescheids
Zunächst ist die Strafbarkeit des T hinsichtlich des Antrags auf Erlass eines Mahnbescheids und daran anschließend eines Vollstreckungsbescheids zu untersuchen.
hemmer-Methode: Bereits diese Aussage enthält eine wichtige Weichenstellung für die folgende Prüfung. Es gilt in diesem Fall, sauber zwischen den verschiedenen Verfahrensabschnitten zu differenzieren. Erst mit dem Antrag an das Vollstreckungsgericht kommt es zu einem Kommunikationsvorgang, der als intellektuelle Einwirkung auf das Vorstellungsbild einer anderen Person1 eine Betrugsstrafbarkeit tragen könnte. Eine kurze Prüfung des § 263 StGB ist, um dieses Verständnis zu zeigen, dennoch angebracht.
Anmerkung: Das Mahnverfahren gem. §§ 688 ff. ZPO ist ein gerichtliches Verfahren, welches der einfachen und schnellen Durchsetzung von Geldforderungen dient. Der Mahnantrag, welcher an das Mahngericht gerichtet ist, verlangt bestimmte standardisierte Angaben, wobei insbesondere der Anspruch zu bezeichnen ist, § 690 I Nr. 3 ZPO. Sind diese und die weiteren Formalia (im Einzelnen § 691 ZPO) eingehalten, ergeht ein Mahnbescheid (§ 692 ZPO), der grundsätzlich keine Schlüssigkeitsprüfung erfordert, vgl. § 692 I Nr. 3 ZPO.2
Dieser wird dem Antragsgegner zugestellt. Erhebt dieser nicht den Rechtsbehelf des Widerspruchs, der strukturell dem Einspruch gegen ein Versäumnisurteil ähnelt (vgl. §§ 694 ff. ZPO), kann auf Antrag des Antragstellers sodann ein Vollstreckungsbescheid ergehen, s. dazu § 699 ZPO. Durch diesen wird der Anspruch tituliert, sodass die Vollstreckung stattfinden kann, vgl. § 794 Nr. 4 ZPO. Eine weitere Anspruchsbegründung ist auch in diesem Verfahrensabschnitt nicht erforderlich, vgl. § 699 I ZPO. Mittels Vollstreckungsbescheid kann, weil dieser gem. § 700 I ZPO einem als vorläufig vollstreckbar erklärtem Versäumnisurteil gleich steht, unmittelbar mit der Zustellung an den Antragsgegner die Vollstreckung betrieben werden.
Diese richtet sich nach den jeweiligen Regeln für die verschiedenen Gegenstände der Zwangsvollstreckung wegen Geldforderungen. Im hier einschlägigen Fall der Vollstreckung in eine Forderung ist ein Antrag zum Vollstreckungsgericht erforderlich vgl. §§ 828 f. ZPO. Auch das Gericht prüft die materielle Berechtigung des titulierten Anspruchs nicht.3 Vielmehr ist der Antragsgegner bzw. nun Vollstreckungsschuldner auf Rechtsbehelfe, allen voran § 767 ZPO oder eine Leistungsklage, gestützt auf § 826 BGB, angewiesen.
1. Strafbarkeit gem. § 263 I StGB
Der objektive Tatbestand des Betrugs gegenüber dem zentralen Mahngericht und zu Lasten der A-GbR ist nicht erfüllt. Es fehlt an einer Täuschung über Tatsachen. Unter einer Täuschung ist jedes Hervorrufen, Aufrechterhalten oder Steigern einer Fehlvorstellung durch intellektuelle Einwirkung auf das Vorstellungsbild einer anderen Person zu verstehen.4 Die Handlungen im Mahnverfahren erfüllen dieses Merkmal nicht. Das Verfahren läuft vollständig automatisiert ab, sodass jeder intellektuelle zwischenmenschliche Kontakt -- etwa mit einem bearbeitenden Rechtspfleger -- fehlt.
2. Strafbarkeit gem. § 263a I Var. 2 StGB
T könnte sich aber, indem er den Mahnbescheid und danach den Vollstreckungsbescheid beantragte, wegen eines Computerbetrugs in der Variante der Verwendung unrichtiger Daten zu Lasten der A-GbR gem. § 263a I Var. 2 StGB strafbar gemacht haben.
a) Objektiver Tatbestand
Der objektive Tatbestand müsste erfüllt sein.
aa) Tathandlung -- Verwenden unrichtiger Daten
Indem T beim Mahnantrag als Anspruchsgrund „Dienstleistungsvertrag gem. Rechnung vom 02.11.2006" angab, könnte er unrichtige Daten verwendet haben. Daten sind alle kodierten Informationen in einer im Wege automatisierter Verarbeitung nutzbaren Darstellungsform.5 Beim automatisierten Mahnantrag, vgl. § 690 III ZPO, ist der Datenbegriff wegen der rein maschinellen Bearbeitung erfüllt. Unrichtig sind die Daten, wenn der durch sie bezeichnete Sachverhalt tatsächlich nicht oder in anderer Weise gegeben ist.6 Auch dies kann hier auf den ersten Blick bejaht werden. Entgegen der Angabe zum Anspruchsgrund stand dem T in Wahrheit kein Anspruch gegen die A-GbR zu.
Gleichwohl ist umstritten, ob beim unberechtigten Mahnantrag § 263a I Var. 2 StGB erfüllt sein kann. Die Streitfrage entzündet sich am eingeschränkten materiellen Prüfungsumfang des Amtsgerichts im Mahnverfahren. Weil dieses den Anspruchsgrund nicht auf Schlüssigkeit hin überprüft, ist fraglich, ob die Falschangabe überhaupt deliktische Relevanz entfaltet.
(1) An Schutzrichtung orientierte Auslegung
Wegen dieser teleologischen Anknüpfung des Meinungsstreits stellt sich zunächst die Frage nach der grundsätzlichen Schutzrichtung des § 263a I StGB und der damit zusammenhängenden Frage einer sachgerechten Auslegung.7
hemmer-Methode: Es ist zu bemerken, dass dieses Problem regelmäßig im Zusammenhang mit der unbefugten Verwendung von Daten gem. § 263a I Var. 3 StGB diskutiert wird. Gleichwohl greift die Streitfrage zum unberechtigten Mahnantrag auf die Position der dort h.M. zurück, sodass die Streitfrage ausnahmsweise auch i.R.d. § 263a I Var. 2 StGB zu erörtern ist.
Dabei vertritt eine Ansicht eine computerspezifische Auslegung des § 263a I StGB und fordert, dass ordnungswidrig in einen Datenverarbeitungsvorgang eingegriffen wird. Das Beschicken eines Systems mit unwahren Daten, die nicht den Systemablauf stören, ist hiernach nicht geeignet, den Tatbestand zu erfüllen, sodass der Computerbetrug hier scheiterte. Demgegenüber positioniert sich eine andere Ansicht, welche die Unrichtigkeit nur vom Willen des hinsichtlich der Daten Berechtigten abhängig macht und den Tatbestand des § 263a StGB bei jedem Widerspruch zu dessen Willen eröffnet. Hiernach könnte ein Verwenden unrichtiger Daten durchaus angenommen werden, weil die verfügungsbefugte A-GbR in Gestalt der anderen Gesellschafter die Verfügung nicht konsentiert. Zum gleichen Ergebnis kommt die h.M., welche den Tatbestand betrugsnah auslegt. Für diese Ansicht ist maßgeblich, ob das fragliche Verhalten gegenüber einem Menschen hypothetisch eine Täuschung darstellen würde.
Ein Streitentscheid ist erforderlich. Dabei ist allein die h.M. in der Lage, dem gesetzgeberischen Willen, die Tatbestandsstruktur des § 263a I StGB bewusst an § 263 StGB anzulehnen, Rechnung zu tragen. Auch der systematische Normzusammenhang bestätigt die Richtigkeit dieser Ansicht gegenüber der abweichenden erstgenannten Auffassung. Schließlich wird nur diese Ansicht dem Telos des § 263a StGB gerecht, Strafbarkeitslücken im Betrugsbereich, die durch die Technisierung des Rechtsverkehrs auftreten, zu schließen.
Mithin kann § 263a I StGB vorliegend grundsätzlich einschlägig sein.
(2) Verwendung unrichtiger Daten bei der Antragstellung im Mahnverfahren
Nach der vorzugswürdigen betrugsnahen Auslegungsrichtung liegt ein Verwenden unrichtiger Daten also dann vor, wenn die Dateneingabe in den automatisierten Bearbeitungsprozess beim Mahngericht den Betrugstatbestand erfüllen würde, wenn ein Mensch die Bearbeitung übernähme. Ob dies beim materiell unberechtigten Mahnantrag der Fall ist, ist umstritten.
Eine Ansicht, die vornehmlich die Rechtsprechung vertritt,8 hält die Anwendung des § 263a StGB für möglich, weil Täuschungsäquivalenz vorliege. Anders als das Vollstreckungsverfahren sei das Mahnverfahren zunächst ein Erkenntnisverfahren. Eine Prüfungskompetenz hinsichtlich der Anspruchsberechtigung ist hier grundsätzlich gegeben. Allein aufgrund der Ausrichtung des Verfahrens entfällt die Prüfung.9 Hätte der Rechtspfleger aber Kenntnis vom Nichtbestehen des Anspruchs, würde er den Mahnbescheid nicht erlassen. Außerdem hat er eine Prüfungsmöglichkeit.10 Dafür spricht auch die prozessuale Wahrheitspflicht gem. § 138 I ZPO, aufgrund welcher der Rechtspfleger von der Richtigkeit der Angaben ausgehen kann und den Anspruch trotz seiner Möglichkeit nicht prüft. Die Norm ist auch im Mahnverfahren anwendbar.11
Die Gegenauffassung lehnt die Erfüllung des Tatbestands des § 263a StGB mangels Täuschungsäquivalenz ab.12 Sie begründet dies damit, dass die erstgenannte Ansicht das Kausalitätserfordernis zwischen Irrtum und Täuschung bei der hypothetischen Betrachtung unzulässig lockere.13 Tatsächlich prüfe der Rechtspfleger beim Vollstreckungsgericht gerade nicht, ob der Anspruch berechtigt ist, was eindeutig in § 692 I Nr. 2 ZPO verankert sei. So könne, auch wenn man dem Rechtspfleger ein sachgedankliches Mitbewusstsein hinsichtlich der Berechtigung des Anspruchs zuschreibt, kein Irrtum eintreten.14 Deshalb gehe auch das Argument mit der Wahrheitspflicht des § 138 I ZPO fehl.15
Gleichwohl ist die erste Auffassung vorzugswürdig, da sie sich auf den eindeutigen gesetzgeberischen Willen stützt16 -- welcher wiederum zutreffend kriminalpolitisch begründet ist -- und die Gegenansicht jedenfalls die Argumentation mit § 138 I ZPO nicht entkräften kann. Die Einhaltung des § 138 I ZPO liegt nämlich ohnehin ohne Zutun des Rechtspflegers in der Sphäre des Antragstellers.17 Schließlich darf nicht übersehen werden, dass die Betrugsähnlichkeit des § 263a StGB keine völlige Identität der Verfügung beim Betrug mit der Beeinflussung eines EDV-Vorgangs dergestalt fordert, dass Abweichungen stets ausgeschlossen wären.18
hemmer-Methode: Die Ansicht der h.L. erscheint dogmatisch zutreffend. Die Rechtsprechung orientiert sich dagegen am gesetzgeberischen Willen und nimmt systematische Friktionen in Kauf. In der Klausur können Sie sich mit guten Argumenten auch auf die Seite der Literatur stellen.
Zwischenergebnis: Die unwahre Angabe des Anspruchsgrunds beim Mahnantrag ist ein Verwenden unrichtiger Daten i.S.d. § 263a I Var. 2 StGB.
bb) Beeinflussung des Ergebnisses eines Datenverarbeitungsvorgangs
Der tatbestandliche Zwischenerfolg der Beeinflussung des Ergebnisses eines Datenverarbeitungsvorgangs ist eingetreten. In der betrugsspezifischen Lesart des § 263a I StGB substituiert das Merkmal die Vermögensverfügung und verlangt eine unmittelbar vermögensrelevante Disposition des Computers.19 Eine solche liegt hier durch die Erzeugung eines Vollstreckungsbescheids mittels EDV unter Einbeziehung der unrichtigen Angabe des Anspruchsgrunds vor.
Es darf aber nicht übersehen werden, dass anhand der betrugsäquivalenten Auslegung des § 263a StGB hier die Konstellation eines Dreieckscomputerbetrugs gegeben ist, weil das Amtsgericht verfügt und ein Schaden eventuell bei der A-GbR eintritt. Die Auflösung des Problems erfolgt entsprechend der Grundsätze zu § 263 StGB.20 Dabei gilt, dass, solange zwischen dem Getäuschtem und dem Verfügenden Personenidentität besteht, in diesem Fall der Betrugstatbestand nicht per se ausgeschlossen ist.
Die Kriterien der Zurechnung einer Verfügung zum Geschädigten, also die Abgrenzung zwischen Dreiecksbetrug und (Trick-)Diebstahl in mittelbarer Täterschaft, sind im Einzelnen umstritten.21 Auf § 263a StGB angewandt bezieht sich das Problem auf das Verhältnis zwischen Geschädigtem und dem Inhaber des betroffenen EDV-Systems, da dessen Arbeitsergebnis der Verfügung gleichkommt. Anhand aller Kriterien genügt dieses Verhältnis hier für eine Zurechnung. Angesichts der Zuständigkeitsverteilung ex lege und der so bestehenden objektiven Verfügungsbefugnis des Amtsgerichts gem. §§ 688 ff. ZPO ist selbst die restriktivste Ansicht in diesem Streit erfüllt. Erst recht besteht das von der h.M. als ausreichend angesehene faktische Näheverhältnis.22
cc) Vermögensschaden
Es ist überdies ein Vermögensschaden eingetreten. Da der Erlass des Mahn- bzw. Vollstreckungsbescheids noch nicht zu einem Vermögensabgang bei der A-GbR führt, ist insoweit auf die schadensgleiche Vermögensgefährdung abzustellen, die die Möglichkeit der Vollstreckung auf Grund des Vollstreckungsbescheids bewirkt.23 Die weiteren erforderlichen Akte, also die Zustellung des Vollstreckungsbescheids und die Einleitung der Zwangsvollstreckung, ändern an diesem Ergebnis nichts. Es handelt sich nur um weitere formale Voraussetzungen, die den Zugriff auf das Vermögen des Vollstreckungsschuldners aufgrund des Vollstreckungsbescheides nicht verhindern können.24
hemmer-Methode: Der Bejahung eines Vermögensschadens könnte die Möglichkeit der Einlegung eines Widerspruchs entgegengehalten werden. Jedoch ist hier zu beachten, dass Mahn- und Vollstreckungsbescheid an die Mutter des T zugestellt wurde, welche eingeweiht war. Prozessuale Abwehrmöglichkeiten stehen daher nicht der Bejahung eines Vermögensschadens entgegen.
dd) Kausalität
Der Kausal- und Zurechnungszusammenhang zwischen den Tatbestandsmerkmalen des § 263a StGB ist gegeben.
Zwischenergebnis: Der objektive Tatbestand des § 263 I Var. 2 StGB ist erfüllt.
b) Subjektiver Tatbestand
T hat Vorsatz hinsichtlich aller objektiven Tatbestandsmerkmale und handelt darüber hinaus mit der Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Selbstbereicherung.
c) Rechtswidrigkeit und Schuld
T handelt rechtswidrig und schuldhaft.
Ergebnis: T ist strafbar wegen eines Computerbetrugs gem. § 263a I Var. 2 StGB.
II. Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses
Womöglich hat sich T zudem durch den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses strafbar gemacht.
1. Strafbarkeit gem. § 263 I StGB
T hat sich keines Betrugs gegenüber dem Gericht und zu Lasten der B strafbar gemacht. Es fehlt jedenfalls am Eintritt eines Schadens bei B, da diese wegen § 836 II ZPO -- die Vollstreckung ist jedenfalls nicht evident nichtig -- schuldbefreiend an T leisten konnte.
2. Strafbarkeit gem. §§ 263 I, (13 I) StGB
T könnte sich wegen eines Betrugs gem. § 263 I StGB, eventuell durch Unterlassen in Verbindung mit § 13 I StGB gegenüber dem Vollstreckungsgericht und zu Lasten der A-GbR strafbar gemacht haben, indem er beim Vollstreckungsgericht die Pfändung und Überweisung der Forderung der A-GbR gegen B auf Grund eines materiell unrichtigen Vollstreckungsbescheides beantragt.
a) Objektiver Tatbestand
Der objektive Tatbestand des Betrugs müsste erfüllt sein. Hierzu ist es zunächst erforderlich, dass T im Sinne des § 263 I StGB täuscht. Eine Täuschung kommt nur gegenüber dem Vollstreckungsgericht in Betracht.
aa) Tatsache
T müsste über eine Tatsache getäuscht haben. Tatsachen sind alle Geschehnisse oder Zustände der Gegenwart oder Vergangenheit, die dem Beweis zugänglich sind.25 Die maßgebliche Tatsache ist i.d.R. das Bestehen bzw. Nichtbestehen eines materiell-rechtlichen Anspruchs, der durch den Vollstreckungsbescheid tituliert wurde. Dieses in der Vergangenheit liegende Faktum ist empirisch nachprüfbar, sodass es den Tatsachenbegriff erfüllt.
bb) Täuschung
Über diese Tatsache müsste T im Sinne der obigen Definition getäuscht haben. Dabei kann ein Täuschungsverhalten in verschiedenen Formen auftreten.
(1) Ausdrückliche Täuschung
T erklärt gegenüber dem Vollstreckungsgericht, handelnd durch den Rechtspfleger (§ 20 I Nr. 17 RPflG), nicht ausdrücklich, auf welche Art der Titel, aus dem vollstreckt wird, zu Stande gekommen ist, sodass eine ausdrückliche Täuschung über das Bestehen der vermeintlichen Forderung gegen die A-GbR aus Dienstvertrag nicht in Betracht kommt.
(2) Täuschung durch schlüssiges Verhalten
Möglicherweise ist aber eine Täuschung durch schlüssiges Verhalten gegeben. Dies wäre dann der Fall, wenn die Tatsache auf Grund des Gesamtverhaltens des T, beurteilt nach der Verkehrsauffassung, für einen objektiven Erklärungsempfänger als miterklärt erscheint.26 Es hat stets eine Gesamtabwägung zu erfolgen, wobei insbesondere die Frage eine Rolle spielt, in wessen Risikosphäre die Abgabe einer Erklärung fällt.27 Wenn diese Sphärenabgrenzung gesetzlich vorgegeben ist, sind die entsprechenden Wertungen, hier die der ZPO, maßgeblich zu berücksichtigen.28 Fraglich ist, ob gemessen an diesem Maßstab im vorliegenden Fall von einer konkludenten Täuschung ausgegangen werden kann.
Im formalisierten Vollstreckungsverfahren prüft das Vollstreckungsorgan -- hier das Vollstreckungsgericht, handelnd durch den Rechtspfleger, § 20 I Nr. 17 ZPO -- von Evidenzfällen abgesehen nicht das Bestehen des materiell-rechtlichen Anspruchs, auf welchem der Titel beruht. Damit korrespondierend ist der einen Pfändungs- und Überweisungsbeschluss Beantragende nicht gehalten, dem Gericht die materiell anspruchsbegründenden Tatsachen mitzuteilen.29 Die Möglichkeiten des Vollstreckungsschuldners, sich gegen eine materiell unberechtigte Vollstreckung zu wehren, sind durch die Rechtsbehelfe des Zwangsvollstreckungsverfahrens -- insbesondere die Vollstreckungsgegenklage gem. § 767 ZPO -- abschließend ausgeformt.30 Daneben bedarf es einer Prüfung durch das Vollstreckungsorgan nicht. Dies gilt insbesondere für die Klage auf Unterlassung der Vollstreckung und Herausgabe des Titels gem. § 826 BGB, wie sie hier in Betracht käme.31 Die Anerkennung dieses Rechtsbehelfs im Falle einer sittenwidrigen Titelerschleichung bestätigt gerade das System des vom Vollstreckungsschuldner zu initiierenden Rechtsschutzes gegen unberechtigte Zwangsvollstreckungsmaßnahmen. Er muss selbst aktiv werden und kann sich nicht auf eine Amtsprüfung des Vollstreckungsorgans verlassen.
Ein weiteres Argument in diese Richtung lässt sich aus § 775 ZPO herleiten. Die Norm lässt Zwangsvollstreckung nur bei bestimmten urkundlich belegten Einwendungen, allen voran die Erfüllung, zu und schützt den Vollstreckungsschuldner darüber hinaus nicht.
Das Erklärungsrisiko hinsichtlich der materiellen Berechtigung des Titels wird von der ZPO demnach dem Vollstreckungsschuldner zugeordnet, sodass diese Tatsache beim Antrag des Gläubigers nicht als schlüssig miterklärt angesehen werden kann. Folglich liegt keine konkludente Täuschung vor.
(3) Täuschung durch Unterlassen
Allenfalls kommt also eine Täuschung durch Unterlassen in Betracht. Dies wäre dann der Fall, wenn der Antragsteller T die relevante Tatsache des Zustandekommens des Titels verschwiegen hätte, obwohl er zur Aufdeckung verpflichtet war, wenn ihn also eine Garantenpflicht trifft, und das Unterlassen der Aufklärung gem. § 13 I StGB a.E. einem positiven Tun gleichsteht.
hemmer-Methode: Auf die Modalitätenäquivalenz des § 13 I StGB a.E. ist insbesondere bei den sogenannten verhaltensgebundenen Delikten -- wie § 263 StGB -- zu achten.
Fraglich ist, ob T für die Aufklärung über das Zustandekommen des Titels Garant ist. Eine solche Stellung könnte sich aus Ingerenz ergeben, wobei das vorwerfbare Vorverhalten in der Durchführung des Mahnverfahrens im Wissen um den fehlenden materiell-rechtlichen Anspruch zu sehen wäre.
Da es sich hierbei um ein strafbares vorsätzliches Verhalten handelt (s.o.), könnte schon fraglich sein, ob daraus überhaupt eine Ingerenzgarantenstellung erwachsen kann.32 Während die Rechtsprechung dies teils mit dem Argument ablehnt, dass eine vorsätzliche Verletzung durch aktives Tun nicht gleichzeitig eine Erfolgsabwendungspflicht begründen kann, nimmt die h.L. den entgegengesetzten Standpunkt ein. Sie stützt sich dabei auf einen „erst-recht-Schluss". Dieser Streit kann vorliegend aber dahinstehen, wenn eine Ingerenzgarantenstellung bereits aus anderen Gründen scheitert.
Eine Garantenstellung aus Ingerenz kommt nämlich nur dann in Frage, wenn das vorwerfbare Vorverhalten die naheliegende Gefahr des Eintritts eines konkreten tatbestandsmäßigen Erfolgs verursacht.33 Mit anderen Worten muss die Tatsituation nach dem Vorverhalten so beschaffen sein, dass ein Untätigbleiben des Täters die Gefahr vergrößert, dass es zum Eintritt eines tatbestandsmäßigen Erfolgs kommt oder der eingetretene Schaden vertieft wird. Daran fehlt es hier. Wäre T nach dem Erlass des Vollstreckungsbescheids untätig geblieben, wären hieraus keine Nachteile für die A-GbR erwachsen. Um das Vermögen der A-GbR nicht nur schadensgleich zu gefährden, sondern zu mindern, war eine weitere Handlung in Form des Vollstreckungsantrags erforderlich. Dieser, hier nach § 829 ZPO gestellte, Antrag beruht auf einem neuen Willensentschluss. Er lässt sich nicht mehr auf das Vorverhalten zurückführen, sodass eine Garantenstellung hieraus in Bezug auf die Antragstellung nicht erwachsen kann.
Folglich fehlt es für eine Täuschung durch Unterlassen an der erforderlichen Garantenstellung.
b) Zwischenergebnis
Der objektive Tatbestand des Betrugs ist mangels einer Täuschung nicht erfüllt.
Anmerkung: An dieser Stelle ist eine andere Ansicht durchaus vertretbar. In diesem Fall stellten sich weitere Probleme. Zunächst müsste der Streit entschieden werden, ob eine Garantenstellung aus Ingerenz bei vorsätzlichem Vorverhalten des Täters in Frage kommt, wobei beide Ansichten mit entsprechender Argumentation gut vertretbar sind.
Daran schlösse sich die Frage des Irrtums des bearbeitenden Rechtspflegers an. Wieder stellt sich ein ähnliches Problem wie im Rahmen des Vollstreckungsbescheides.
Der Rechtspfleger prüft auch in diesem Verfahrensstadium nicht die materielle Berechtigung des Anspruchs. An dieser Stelle könnte, wie vom BGH im vorliegenden Fall mangels Relevanz offengelassen, die Rechtsfigur des sachgedanklichen Mitbewusstseins angewendet werden. Die Argumentation müsste dann daran anknüpfen, dass der Rechtspfleger zumindest latent davon ausgeht, dass die Forderung berechtigt ist.
Des Weiteren wäre wiederum die Konstellation des Dreiecksbetrugs zu beachten, die entsprechend obiger Argumentation aufgrund der Befugnis des Vollstreckungsgerichts gem. § 828 I, II ZPO zu lösen wäre.
3. Strafbarkeit gem. § 263a I StGB
T könnte sich zudem wegen eines Computerbetrugs gem. § 263a I Var. 2 StGB strafbar gemacht haben. Doch fehlt es hierfür schon an einer tauglichen Tathandlung des § 263a StGB. T beeinflusst durch den Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses nicht einen Datenverarbeitungsvorgang, sondern wirkte auf die Vorstellung des beim Vollstreckungsgericht zuständigen Rechtspflegers ein.
hemmer-Methode: Es gilt das Gleiche wie oben zum Betrug ausgeführt: Zwar ist hier eindeutig ersichtlich, dass ein Computerbetrug scheitert. Die (kurze!) Prüfung des Delikts eignet sich aber, um nochmals zu demonstrieren, dass der Fall vollständig durchdrungen wurde.
III. Ergebnis
T hat sich wegen Computerbetrugs gem. § 263a I Var. 2 StGB gegenüber dem Mahngericht und zu Lasten der A-GbR strafbar gemacht.
D) Kommentar
(bb). Die dem Fall zugrundeliegende Entscheidung des BGH zeigt anschaulich, dass stets präzise auf der Basis der konkreten tatsächlichen und rechtlichen Umstände auszulegen ist. Aufgrund der „Vernetzung" mit Grundlagen des Zwangsvollstreckungsrechts ist die BGH-Entscheidung sehr interessant. Falls beim Antrag auf Erlass eines Pfändungs- und Überweisungsbeschlusses mit nachvollziehbarer Begründung eine Betrugsstrafbarkeit bejaht worden wäre, stellt sich das nachgelagerte Problem, wie der Computerbetrug und der nachfolgende Betrug konkurrenzrechtlich zueinander stehen. Es dürfte wohl überzeugen, ähnlich wie beim Verhältnis von Eingehungs- und nachfolgendem (unechten) Erfüllungsbetrug der späteren Realisierung des Schadens in konkurrenzrechtlicher Hinsicht keine maßgebliche Bedeutung beizumessen. Demzufolge würde der nachfolgende Betrug richtigerweise in Gesetzeskonkurrenz hinter dem Computerbetrug zurücktreten.
Wichtig für die richtige Falllösung ist insbesondere auch die Kenntnis von der Rechtsprechung, dass bei einer hinreichend konkreten Vermögensgefährdung, bei welcher sich ein wirtschaftlicher Mindestschaden bestimmen lässt, bereits ein Vermögensschaden anzunehmen ist und damit bereits eine Vollendungsstrafbarkeit in Betracht kommt (im Fall der Computerbetrug durch die Beantragung von Mahn- und Vollstreckungsbescheid). Instruktiv und sehr prüfungsrelevant hierzu auch der sog. „Sportwettenbetrug", vgl. BGH, Urteil vom 20.12.2012 -- 4 StR 55/12 = Life & Law 2013, 58 ff.
E) Zur Vertiefung
- Zur Täuschung bei § 263 I StGB
Hemmer/Wüst, Strafrecht BT I, Rn. 123 ff.
- Zum Computerbetrug
Hemmer/Wüst, Strafrecht BT I, Rn. 175 ff.
F) Wiederholungsfragen
- Kann ein bewusst unberechtigter Mahnantrag, aufgrund dessen Mahn-
und Vollstreckungsbescheid ergehen, den Tatbestand des § 263a StGB erfüllen?
- Ist der Antrag auf Durchführung einer Vollstreckungshandlung aufgrund eines unrichtigen Titels eine Täuschung i.S.d. § 263 I StGB?
-
Zur Definition der h.M. vgl. Fischer, § 263 StGB, Rn. 14.↩
-
Vgl. Zöller, § 691 ZPO, Rn. 1; ein Prüfungsrecht kann aber im Einzelfall bestehen, vgl. ebd.↩
-
Vgl. Zöller, § 829 ZPO, Rn. 4.↩
-
Vgl. Lackner/Kühl, § 263 StGB, Rn. 6.↩
-
Vgl. Fischer, § 263a StGB, Rn. 3.↩
-
Vgl. Fischer, § 263a StGB, Rn. 3.↩
-
Instruktiv zum Streitstand Fischer, § 263a StGB, Rn. 10 ff.; vgl. auch Lackner/Kühl, § 263a StGB, Rn. 12 f. mit überzeugender Argumentation für die h.M.↩
-
Vgl. BGH, NStZ 2012, 322, 323 m.w.N.; OLG Celle, NStZ-RR 2012, 111, 112; vgl. daneben NK-StGB, § 263a StGB, Rn. 18; Dannecker, BB 1996, 1285, 1289; Möhrenschlager, wistra 1986, 128, 132.↩
-
Vgl. BGH, NStZ 2012, 322, 323; zum Zivilprozessrecht insoweit Zöller, § 691 ZPO, Rn. 1.↩
-
Vgl. LK-StGB, § 263a StGB, Rn. 68.↩
-
Zöller, Vor § 688 ZPO, Rn. 7.↩
-
So Schönke/Schröder, § 263a StGB, Rn. 6 m.w.N.; Satzger/Schluckebier/Widmaier, § 263a StGB, Rn. 6; Kretschmer, GA 2004, 458, 470.↩
-
Vgl. Kretschmer, GA 2004, 458, 470.↩
-
Vgl. Trüg, NStZ 2014, 157, 158.↩
-
Vgl. Trüg, NStZ 2014, 157, 158.↩
-
Vgl. BT-Drucks. 10/318, S. 20 f.↩
-
Vgl. NK-StGB, § 263a StGB, Rn. 18.↩
-
Vgl. LK-StGB, § 263a StGB, Rn. 68.↩
-
Vgl. Fischer, § 263a StGB, Rn. 20.↩
-
Vgl. Schönke/Schröder, § 263a StGB, Rn. 22.↩
-
Zum Dreiecksbetrug Satzger/Schluckebier/Widmaier, Rn. 184 ff., 191.↩
-
Hierzu bei § 263a StGB Schönke/Schröder, § 263a StGB, Rn. 22.↩
-
Vgl. MK-StGB, § 263 StGB, Rn. 674.↩
-
Vgl. in einem ähnlichen Fall, der aber nicht das Mahnverfahren betrifft, BGH, NStZ 2013, 586, 587.↩
-
Vgl. Schönke/Schröder, § 263 StGB, Rn. 8.↩
-
Vgl. BGH, NStZ 2013, 234, 235 m.w.N; Schönke/Schröder, § 263 StGB, Rn. 14/15.↩
-
Vgl. Schönke/Schröder, § 263 StGB, Rn. 14/15.↩
-
Vgl. Wagemann, GA 2007, 146, 148 f.↩
-
Vgl. Musielak, § 829 ZPO, Rn. 2.↩
-
Vgl. BGHZ 190, 172, 183 betreffend die vollstreckungsrechtlichen Klauselrechtsbehelfe.↩
-
Vgl. BGHZ 103, 44, 44 ff.↩
-
Zum Streitstand vgl. Fischer, § 13 StGB, Rn. 54 ff.↩
-
Vgl. BGHSt 54, 44, 47; vgl. auch Schönke/Schröder, § 13 StGB, Rn. 42.↩