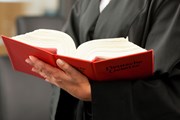+++ Bundespräsident +++ Kompetenzen +++ Prüfungsrecht +++
Sachverhalt: Um zukünftigen Regierungsmehrheiten im Bundestag mehr Handlungsfreiheit zu geben, beschließen Bundestag und Bundesrat in ordnungsgemäßem Verfahren mit der erforderlichen Mehrheit von jeweils zwei Dritteln der Stimmen, die meisten Zustimmungserfordernisse des Bundesrats zur Bundesgesetzgebung im Grundgesetz abzuschaffen (z.B. Art. 74 II, 74a II, III, 84 I, 85 I, 104a III S. 3, 105 III GG). Als Ausgleich dafür werden den Ländern verschiedene Zuständigkeiten vom Bund übertragen. Die Bundespräsidentin ist eher für versöhnen statt spalten und hält das Gesetz für verfassungswidrig. Sie verweigert die Ausfertigung des Gesetzes. Die Mehrheit im Bundestag, die diesen „Befreiungsschlag" unbedingt noch vor den Bundestagswahlen im Gesetzblatt sehen möchte, beantragt daher vor dem BVerfG, die Bundespräsidentin dazu zu verpflichten.
Bearbeitervermerk: Hat der Antrag Erfolg?
A) Sound
Kann der Bundespräsident die Ausfertigung verfassungswidriger Gesetze verweigern?
B) Gliederung
Organstreit, Art. 93 I Nr. 1 GG
1. Zulässigkeit
a) Zuständigkeit des BVerfG
b) Parteifähigkeit
c) Verfahrensgegenstand
d) Antragsbefugnis
e) Form und Frist
2. Begründetheit
a) Formelles Prüfungsrecht des Bundespräsidenten
b) Materielles Prüfungsrecht des Bundespräsidenten?
c) Materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes
Es handelt sich um ein verfassungsänderndes Gesetz
aa) Verfassungswidriges Verfassungsrecht?
bb) Grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung, Art. 79 III GG
Erfordert keine Zustimmungsgesetze
cc) Grundsätze des Bundesstaats, Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 I GG
Bundesstaat = Staatsqualität, d.h. eigene Staatsgewalt der Länder, nicht aber Mitwirkung an der Staatsgewalt des Bundes
Kein Verstoß gegen Art. 79 III GG
BPräs muss Gesetz ausfertigen und verkünden
3. Ergebnis
Antrag erfolgreich
C) Lösung
Der Antrag ist erfolgreich, wenn er zulässig und begründet ist.
1. Zulässigkeit
a) Zuständigkeit des BVerfG
Das BVerfG entscheidet gem. Art. 93 I Nr. 1 GG, § 13 Nr. 5 BVerfGG über Organstreitverfahren.
b) Parteifähigkeit
Partei eines Organstreits können gem. § 63 BVerfGG der Bundestag und die Bundespräsidentin sein. Die Parteifähigkeit liegt vor.
hemmer-Methode: Das Organ „Bundestag" i.S.v. § 63 BVerfGG ist identisch mit der Mehrheit des Bundestags.
Es ist nicht erforderlich, dass alle Bundestagsabgeordneten diesem Antrag zustimmen. Der Bundestag handelt wie jedes Kollegialorgan grundsätzlich „durch seine Mehrheit".
c) Verfahrensgegenstand
Verfahrensgegenstand ist der Streit um gegenseitige Rechte und Pflichten aus dem Grundgesetz.1 Hier ist die Frage, ob die Bundespräsidentin das Recht des Bundestags aus Art. 76 ff., 82 I GG verletzt hat. Diese Vorschriften enthalten ein Recht des Bundestags, dass die Bundespräsidentin die Gesetze ausfertigt und verkündet.
d) Antragsbefugnis
Gem. § 64 I BVerfGG muss der Antragsteller geltend machen, dass die Maßnahme oder Unterlassung des Antragsgegners ihn oder das Organ, dem er angehört, in seinen Rechten und Pflichten aus dem Grundgesetz verletzt oder unmittelbar gefährdet.
Die Unterlassung der Bundespräsidentin liegt hier darin, dass sie das Gesetz nicht ausfertigt und verkündet.
Hierzu ist die Bundespräsidentin aber nach Art. 82 I GG grundsätzlich verpflichtet. Ob dies ausnahmsweise anders ist, wenn das auszufertigende Gesetz verfassungswidrig ist, d.h. der Bundespräsidentin ein Prüfungsrecht zusteht, ist eine Frage der Begründetheit.
hemmer-Methode: Sicher ist, dass dem Bundespräsidenten kein politisches „Prüfungsrecht" zusteht.2 Er kann also nicht deshalb die Ausfertigung verweigern, weil er das Gesetz für politisch falsch hält.
Die (politische) Entscheidung über den Inhalt der Gesetze obliegt den Organen der Gesetzgebung, d.h. Bundestag und Bundesrat.
Da die Pflicht zur Ausfertigung grundsätzlich besteht, kann der Bundestag eine Verletzung seiner Rechte gem. Art. 76 ff., 82 I GG geltend machen. Er ist antragsbefugt.
e) Form und Frist
Form und Frist (§ 64 II, III BVerfGG) müssten eingehalten werden. Hiervon ist auszugehen.
2. Begründetheit
Der Organstreit ist begründet, wenn die Unterlassung der Bundespräsidentin die Rechte des Bundestags aus Art. 76 ff., 82 I GG verletzt.
Gem. Art. 82 I GG ist der Bundespräsident zur Ausfertigung und Verkündung der Gesetze verpflichtet. Fraglich ist jedoch, ob dies ausnahmslos gilt, oder ob der Bundespräsident dies bei verfassungswidrigen Gesetzen verweigern kann.
Das betrifft die Frage nach dem Prüfungsrecht des Bundespräsidenten bei Gesetzen.
Dies ist im Grundgesetz nicht ausdrücklich geregelt. Art. 82 I GG spricht lediglich davon, dass der Bundespräsident die Gesetze ausfertigt und verkündet, „die nach den Vorschriften dieses Grundgesetzes zustande gekommen" sind.
a) Formelles Prüfungsrecht des Bundespräsidenten
Hierin wird nach allg. Meinung ein formelles Prüfungsrecht des Bundespräsidenten angenommen. Der Bundespräsident kann überprüfen, ob das Gesetz formell verfassungswidrig ist, und die Ausfertigung und Verkündung verweigern, wenn dies tatsächlich so ist.
Hierzu gehört die Zuständigkeit des Bundes für die Gesetzgebung3 gem. Art. 70 ff. GG, sowie das ordnungsgemäße Verfahren der Gesetzgebung nach Art. 76, 77 GG.
Dieses umfasst zum einen die Gesetzesinitiative, die gem. Art. 76 I GG der Bundesregierung, den Abgeordneten des Bundestags („aus der Mitte des Bundestags"), und dem Bundesrat zusteht.
Zum anderen ist dies das in den Art. 76, 77 GG beschriebene Verfahren mit Beteiligung von Bundestag, Bundesrat und Bundesregierung.
Im vorliegenden Fall ist die Bundespräsidentin jedoch nicht wegen ihres formellen Prüfungsrechts zur Verweigerung von Ausfertigung und Verkündung berechtigt, denn das Gesetz ist formell verfassungsgemäß.
Die Zuständigkeit des Bundes für die Änderung des Grundgesetzes ergibt sich, wenn man sie nicht schon aus Art. 79 I, II GG entnimmt, jedenfalls kraft Natur der Sache. Denn die Änderung des Grundgesetzes kann begriffsnotwendig nur durch den Bund selbst erfolgen.
Zudem ist von der Ordnungsmäßigkeit des Verfahrens bei der Gesetzgebung laut Sachverhalt auszugehen. Insbesondere ist auch das spezielle Mehrheitserfordernis für Änderungen des Grundgesetzes gem. Art. 79 II GG von zwei Dritteln der Mitglieder von Bundestag und Bundesrat gewahrt.
b) Materielles Prüfungsrecht des Bundespräsidenten?
Umstritten ist jedoch, ob dem Bundespräsidenten auch ein materielles Prüfungsrecht zusteht mit der Konsequenz, dass er die Ausfertigung und Verkündung eines Gesetzes verweigern kann, wenn es materiell verfassungswidrig ist.
Aus dem Wortlaut des Art. 82 I GG ist diese Frage nicht eindeutig zu beantworten. Mit der Formulierung „zustande gekommen" können sowohl nur formelle Aspekte, aber auch das gesamte Verfassungsrecht gemeint sein.
aa) Art. 78 GG
Allerdings wird in Art. 78 GG eine beinahe identische Formulierung gewählt („kommt zustande"). In dieser Vorschrift sind ohne Zweifel nur formelle Vorschriften, nämlich die dort genannten, gemeint. Art. 82 I GG könnte daher entsprechend auszulegen sein.
Die systematische Auslegung spricht insoweit gegen die Annahme eines materiellen Prüfungsrechts.
bb) Funktion des BVerfG
Aus Stellung und Funktion des BVerfG lässt sich hingegen zu der Frage, ob dem Bundespräsidenten dieses Prüfungsrecht zusteht, wenig herleiten.
Richtig ist zwar, dass nach dem Grundgesetz das BVerfG zur letztverbindlichen Entscheidung über die Verfassungsmäßigkeit von Gesetzen berufen ist, wie sich aus den Vorschriften über die abstrakte Normenkontrolle (Art. 93 I Nr. 2 GG) wie auch der konkreten Normenkontrolle (Art. 100 I GG) entnehmen lässt.4
Diese Stellung des BVerfG würde jedoch durch die Annahme eines umfassenden Prüfungsrechts des Bundespräsidenten nicht eingeschränkt. Die Befugnis des BVerfG zur letztverbindlichen Entscheidung würde dadurch nicht berührt.
Denn das BVerfG ist auch für die Entscheidung über Streitigkeiten zwischen den Verfassungsorganen berufen (Art. 93 I Nr. 1 GG). Wie im hier vorliegenden Fall, entscheidet das BVerfG dann über einen Organstreit gegen den Bundespräsidenten, der sein Prüfungsrecht ausübt.
cc) Amtseid des Bundespräsidenten (Art. 56 GG)
Ebenso lässt sich aus dem Amtseid des Bundespräsidenten nichts über die Frage eines Prüfungsrechts gewinnen.5
Zwar verpflichtet ihn dieser zur Wahrung des Grundgesetzes.
Diese Pflicht obliegt jedoch allen Verfassungsorganen, und nicht nur diesen, sondern jeder Staatsgewalt. Dabei hat jedes Organ seine spezifischen Zuständigkeiten (Kompetenzen), innerhalb derer es die Verfassung zu beachten hat.
Eine Verpflichtung und ein daraus folgendes Recht eines Organs, im Verhältnis zu anderen Verfassungsorganen das Grundgesetz zu wahren, muss sich daher aus dem Grundgesetz selbst ergeben, nicht schon aus der bloßen Existenz des Organs.
Ob der Bundespräsident bei der Aufgabe, Gesetze auszufertigen und zu verkünden, auch dazu befugt ist, deren Verfassungsmäßigkeit zu überprüfen, ist jedoch gerade die Frage, um die es hier geht.
dd) Präsidentenanklage Art. 61 GG
Das Gleiche wird man hinsichtlich der Möglichkeit einer Präsidentenanklage (Art. 61 GG) feststellen müssen. Zwar ergibt sich hieraus, dass der Bundespräsident nicht das Grundgesetz oder ein anderes Bundesgesetz vorsätzlich verletzen darf.
Hieraus folgen jedoch keine Konsequenzen für ein Prüfungsrecht oder eine Prüfungspflicht des Bundespräsidenten i.R.d. Art. 82 I GG.
Ein Gesetz mag verfassungswidrig sein, und deshalb eine Verletzung des Grundgesetzes darstellen. Dadurch haben die Organe, die über den Inhalt des Gesetzes entschieden haben, die Verfassung verletzt (d.h. der Bundestag und ggf. der Bundesrat).
Eine andere Frage ist jedoch, ob der Bundespräsident das Grundgesetz verletzt, wenn er ein verfassungswidriges Gesetz ausfertigt und verkündet, und er deshalb - bei Vorsatz - gem. Art. 61 GG angeklagt werden könnte.
Aus Art. 61 GG auf ein Prüfungsrecht zu schließen, wäre daher ebenso ein Zirkelschluss wie im Zusammenhang mit Art. 56 GG (Amtseid).
ee) Stellung des Bundespräsidenten im Grundgesetz
Z.T. wird gegen ein materielles Prüfungsrecht eingewandt, dass dies der sonstigen Stellung des Bundespräsidenten im Grundgesetz widersprechen würde.
Dieser habe fast keine politischen Entscheidungsbefugnisse, sondern sei auf die bloß repräsentative Funktion als Staatsoberhaupt sowie als „Staatsnotar" beschränkt.6
Zu diesen gehören die völkerrechtliche Vertretung und der Abschluss der Verträge mit auswärtigen Staaten gem. Art. 59 I GG, die Ernennung des Bundeskanzlers (Art. 63 II S. 2 GG), der Bundesminister (Art. 64 I GG) und der Bundesbeamten und Soldaten (Art. 60 GG).
Hierbei hat der Bundespräsident keine eigenständigen Entscheidungsbefugnisse. Vielmehr entscheiden andere Organe, und der Bundespräsident „vollzieht" lediglich.
Einzige echte politische Befugnisse des Bundespräsidenten bestehen bei der Wahl des Bundeskanzlers mit relativer Mehrheit gem. Art. 63 IV S. 3 GG sowie bei der Auflösung des Bundestags gem. Art. 68 GG bei Verlust der Vertrauensfrage des Bundeskanzlers.
hemmer-Methode: I.R.d. Art. 68 GG ist allerdings die Entscheidungsbefugnis des Bundespräsidenten wiederum nach der Rspr. des BVerfG erheblich eingeschränkt. Die Befugnis zur Auflösung des Bundestags besteht nur bei entsprechendem Vorschlag des Bundeskanzlers, vgl. Art. 68 I S. 1 GG. Dem Bundeskanzler steht jedoch dabei eine „Einschätzungsprärogative" zu, d.h. der Bundespräsident hat dessen Vorschlag grundsätzlich zu folgen.7
Aus dieser ganz überwiegend lediglich repräsentativen Position des Bundespräsidenten kann jedoch nicht geschlossen werden, dass jegliche Befugnisse grundsätzlich „eng" auszulegen sind.
Demnach kann aus der Stellung des Bundespräsidenten im Grundgesetz nicht gegen ein materielles Prüfungsrecht argumentiert werden.8
ff) Stellung des Bundespräsidenten als Verfassungsorgan
Gem. Art. 20 III GG ist der Bundespräsident wie jedes andere Staatsorgan an die Verfassung gebunden.
Unabhängig von der im Einzelnen bestehenden Kompetenzverteilung unter den Verfassungsorganen kann angenommen werden, dass ein Verfassungsorgan nicht verpflichtet sein kann, zu einem offensichtlichen Verfassungsbruch beizutragen.
Daher ist mit der h.M.9 das Recht des Bundespräsidenten zu einer sog. Evidenzkontrolle anzunehmen. Er muss zumindest ein offensichtlich verfassungswidriges Gesetz nicht ausfertigen und verkünden. Eine derartige Verpflichtung wäre mit der Stellung als Verfassungsorgan nicht vereinbar.
Dabei ist auch zu berücksichtigen, dass der Bundespräsident nicht die Möglichkeit hat, das Gesetz durch das BVerfG überprüfen zu lassen, da er nicht parteifähig i.R.d. abstrakten Normenkontrolle nach Art. 93 I Nr. 2 GG ist.10
hemmer-Methode: Hieraus könnte jedoch auch gegen das materielle Prüfungsrecht argumentiert werden. Denn das Prüfungsrecht führt letztlich dazu, dass der Bundespräsident eine Überprüfung des Gesetzes durch das BVerfG vor dessen Inkrafttreten veranlassen kann, wenn der Bundestag einen Organstreit anstrengt. Dennoch sollten Sie schon aus klausurtaktischen Gründen jedenfalls der vermittelnden Ansicht (Evidenzkontrolle) folgen, damit Sie zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes kommen!
Anders als im wirklichen Leben gilt: Probleme schaffen, nicht wegschaffen!
c) Materielle Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes
Der Bundespräsident kann daher Ausfertigung und Verkündung jedenfalls dann verweigern, wenn das Gesetz offensichtlich verfassungswidrig ist.
Es ist daher die (materielle) Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zu prüfen.
aa) Verfassungswidriges Verfassungsrecht?
Es handelt sich jedoch nicht um ein einfaches Gesetz, sondern um ein verfassungsänderndes Gesetz, mit dem die Vorschriften des Grundgesetzes geändert wurden, die eine Zustimmung des Bundesrats zu den Bundesgesetzen regeln. Fraglich ist, an welchem Maßstab ein solches verfassungsänderndes Gesetz zu prüfen ist.
Prüfungsmaßstab für jegliches Recht kann stets nur höherrangiges Recht sein. Ein „Verstoß" ist nur denkbar, wenn es sich um höherrangiges Recht handelt. Gegen gleichrangiges Recht kann eine Regelung niemals verstoßen, sie kann dieser allenfalls widersprechen, was zu einer Verdrängung einer der Vorschriften nach den Grundsätzen des spezielleren oder des späteren Rechts führt.
Ein verfassungsänderndes Gesetz ist selbst (neues) Verfassungsrecht und daher gleichrangig mit dem („alten") Grundgesetz. Fraglich ist daher, ob eine Verfassungsänderung überhaupt irgendwelchen Bindungen unterliegt. Dies ist die Frage nach verfassungswidrigem Verfassungsrecht.
Genau diese Frage regelt Art. 79 III GG. Diese Vorschrift betrifft den Fall von Verfassungsänderungen und unterwirft diese bestimmten Bindungen.
Ist Art. 79 III GG verletzt, so liegt der Fall verfassungswidrigen Verfassungsrechts vor.
Art. 79 III GG hebt bestimmte Vorschriften des Grundgesetzes heraus und macht sie einer Änderung unzugänglich. Art. 79 III GG beinhaltet daher eine Ewigkeitsgarantie zugunsten der dort genannten Prinzipien.
Danach sind die Gliederung des Bundes in Länder (und damit weitgehend das Bundesstaatsprinzip), die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung sowie die in den Art. 1 GG und Art. 20 GG (nicht: Art. 1 bis 20 GG) niedergelegten Grundsätze unabänderlich.
bb) Grds. Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung, Art. 79 III GG
Durch die Verfassungsänderung könnte die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung berührt sein. Diese beinhaltet, dass die Länder bei der Gesetzgebung des Bundes mitwirken, d.h. bei den Bundesgesetzen.
hemmer-Methode: Auch eigene Zuständigkeiten der Länder zur Gesetzgebung sollen hiervon umfasst sein.11 Dies ist aber nicht notwendig, da dies schon durch Art. 79 III GG i.V.m. dem Bundesstaatsprinzip gem. Art. 20 I GG geschützt ist, denn zu der Staatsqualität der Länder gehört die eigene Gesetzgebung.
Dies erfolgt nach dem Grundgesetz in der Form des Bundesrats (vgl. Art. 50 GG), in dem die Länder durch ihre Regierungen vertreten sind, Art. 51 I GG.
Der Bundesrat wirkt nach Art. 77 GG bei der Gesetzgebung des Bundes mit, darüber hinaus gem. Art. 80 II GG an bestimmten Rechtsverordnungen. Bei der Gesetzgebung ist zwischen Einspruchs- und Zustimmungsgesetzen zu unterscheiden. Bei ersteren verbleibt die endgültige Entscheidung über das Gesetz beim Bundestag, während Zustimmungsgesetze nur mit der Zustimmung des Bundesrats zustande kommen.
Durch die Verfassungsänderung werden nun fast alle Zustimmungserfordernisse abgeschafft. Dies führt dazu, dass es in Zukunft (fast) nur noch Einspruchsgesetze geben wird, und daher die tatsächlichen Einflussmöglichkeiten des Bundesrats erheblich herabgesetzt sind.
Wie sich in der Vergangenheit gezeigt hat, werden in Konfliktfällen die Gesetze, die lediglich Einspruchsgesetze sind, auch in aller Regel durch den Bundestag gegen den Willen des Bundesrats durchgesetzt.
Art. 79 III GG spricht jedoch lediglich von der „Mitwirkung", und diese muss auch nur grundsätzlich gegeben sein. Dabei ist jedenfalls nicht der gegenwärtige Umfang der Mitwirkung geschützt.12
Zudem bedeutet die Formulierung „Mitwirkung" lediglich eine Beteiligung bei der Gesetzgebung, etwa in Form des Initiativrechts (Art. 76 I GG) und der Möglichkeit der Befassung und Stellungnahme mit Gesetzesentwürfen, wie dies in Art. 76, 77 GG vorgesehen ist.
Mitwirkung bedeutet nicht, dass die Zustimmung zu bestimmten Vorhaben erforderlich sein muss.
Es beinhaltet kein „Veto-Recht", wie dies dem Bundesrat gegenwärtig bei den Zustimmungsgesetzen zusteht.13
Art. 79 III GG erfordert daher nicht, dass bestimmte Bundesgesetze von der Zustimmung des Bundesrats und damit der Mehrheit der Länder abhängig sind. Die grundsätzliche Mitwirkung der Länder bei der Gesetzgebung ist nicht in Frage gestellt. Insoweit verstößt die Verfassungsänderung nicht gegen Art. 79 III GG.
hemmer-Methode: Möglich wäre sogar, einen Teil der Bundesgesetze in einem neuen Verfahren völlig ohne Beteiligung des Bundesrats beschließen zu lassen, denn Art. 79 III GG fordert nur die „grundsätzliche" Mitwirkung. Dies dürfte allerdings quantitativ und qualitativ nur in geringem Ausmaß zulässig sein.
cc) Grundsätze des Bundesstaats gem. Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 I GG
Durch die Abschaffung der Zustimmungserfordernisse könnte das Bundesstaatsprinzip verletzt sein, das in seinen „Grundsätzen" von Art. 79 III GG geschützt ist.
Denn in den wichtigen Bereichen der Verwaltungsorganisation (Art. 84 I, 85 I GG) und der Finanzen (Art. 104a III S. 3, 105 III GG) ist dann keine Zustimmung des Bundesrats mehr erforderlich.
Fraglich ist jedoch, ob dies das Bundesstaatsprinzip berührt. Denn dieses garantiert v.a. die Staatsqualität der Länder.
Danach müssen den Ländern substantielle Befugnisse im Bereich aller drei Staatsfunktionen Gesetzgebung, Verwaltung und Rechtsprechung zustehen. Zudem muss den Ländern die unabhängige Ausübung dieser Staatsgewalt zustehen.14
Nicht von der Staatsqualität der Länder erfasst wird aber deren Mitwirkung bei der Gesetzgebung des Bundes. Die Staatlichkeit der Länder garantiert deren eigene, unabhängige Ausübung von Staatsgewalt, und schützt diese vor Entzug und Aushöhlung, nicht aber die Mitwirkung an der Ausübung von Staatsgewalt des Bundes über den Bundesrat.15
Dies wird schon daraus deutlich, dass dem einzelnen Land insoweit auch bei Zustimmungsgesetzen keine eigenständigen Befugnisse zustehen. Denn einzelne Länder können überstimmt werden. Nur die Mehrheit des Bundesrats gem. Art. 51 II, 52 III S. 1 GG und damit eine Mehrzahl von Ländern kann tatsächlich Befugnisse ausüben und das Bundesgesetz verhindern.
Dass die Mitwirkung an der Gesetzgebung des Bundes nicht vom Bundesstaatsprinzip umfasst ist, wird auch in Art. 79 III GG deutlich. Dieser geht gerade vom Gegenteil aus, indem er die Mitwirkung an der Gesetzgebung ausdrücklich erwähnt, neben der „Gliederung des Bundes in Länder" und dem Verweis auf die Grundsätze des Art. 20 GG.
Dies bedeutet, dass die Frage, ob gegen das Bundesstaatsprinzip bzw. dessen Grundsätze (vgl. Art. 79 III GG) verstoßen wird, unabhängig davon ist, in welchem Umfang den Ländern eine Mitwirkung bei der Bundesgesetzgebung eingeräumt ist.
Würde man die verfassungsrechtliche Lage nach der Verfassungsänderung als Verstoß gegen Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 I GG ansehen, so wäre dies auch schon vorher der Fall gewesen.
Staatsqualität bedeutet, dass den Ländern substantielle Staatsgewalt zusteht, und dass sie diese unabhängig ausüben.
Dies bedeutet nicht Teilhabe an der Staatsgewalt des Bundes. Ein Mangel an „Staatsqualität" kann daher nicht durch vermehrte Mitwirkung an der Bundesstaatsgewalt kompensiert werden.
hemmer-Methode: A.A. vertretbar, d.h. dass eigene Staatsgewalt der Länder durch die Mitwirkung an der Bundesgesetzgebung ersetzt wird.16 Dass die Entwicklung in den vergangenen Jahrzehnten dahin ging, insbesondere Gesetzgebungsbefugnisse der Länder auf den Bund zu verlagern, und im Gegenzug der Bundesrat an Bedeutung gewonnen hat, hat aber auf die Auslegung des Art. 79 III GG keinen Einfluss.
Daher sind auch nicht die Grundsätze des Bundesstaats gem. Art. 79 III GG i.V.m. Art. 20 I GG verletzt.
hemmer-Methode: Eine Auseinandersetzung in diesem Umfang wird in einer Klausur von Ihnen nicht erwartet. Sie dient hier auch der Darstellung des Bundesstaatsprinzips17.
Es liegt kein verfassungswidriges Verfassungsrecht vor.
Das verfassungsändernde Gesetz ist nicht verfassungswidrig. Daher durfte die Bundespräsidentin nicht dessen Ausfertigung verweigern.
Sie hat dadurch die Rechte des Bundestags aus Art. 76 ff., 82 I GG verletzt. Der Organstreit ist begründet.
3. Ergebnis
Der Bundestag kann erfolgreich vor dem BVerfG vorgehen.
D) Zusammenfassung
- Der Bundespräsident kann die Ausfertigung und Verkündung eines Gesetzes (Art. 82 I GG) verweigern, wenn das Gesetz formell verfassungswidrig ist (formelles Prüfungsrecht). Ein materielles Prüfungsrecht ist str., wird aber von der h.M. bejaht.
- Für Verfassungsänderungen gilt die „Ewigkeitsgarantie" des Art. 79 III GG. Bei einem Verstoß gegen diese Bestimmung liegt verfassungswidriges Verfassungsrecht vor.
Sound: Der Bundespräsident hat ein formelles (unstr.) und nach h.M. auch ein materielles Prüfungsrecht i.R.d. Art. 82 I GG.
-
Hemmer/Wüst, Staatsrecht II, Rn. 8.↩
-
Hemmer/Wüst, Grundwissen Staatsrecht, Rn. 317.↩
-
Jarass/Pieroth, Art. 82 GG, Rn. 3.↩
-
Hemmer/Wüst, Grundwissen Staatsrecht, Rn. 322.↩
-
Hemmer/Wüst, Grundwissen Staatsrecht, Rn. 321.↩
-
Degenhart, Rn. 553, 555.↩
-
BVerfGE 62, 1, 50; Degenhart, Rn. 535, 571.↩
-
Hemmer/Wüst, Staatsrecht II, Rn. 222.↩
-
Degenhart, Rn. 566; Jarass/Pieroth, Art. 82 GG, Rn. 3.↩
-
Hemmer/Wüst, Grundwissen Staatsrecht, Rn. 323.↩
-
Degenhart, Rn. 693.↩
-
Jarass/Pieroth, Art. 79 GG, Rn. 9.↩
-
A.A. vertretbar, vgl. dazu v. Münch/Kunig, Art. 79 GG, Rn. 32.↩
-
Degenhart, Rn. 99.↩
-
Degenhart a.a.O.↩
-
Vgl. dazu v. Münch/Kunig, Art. 79 GG, Rn. 31.↩
-
Vgl. auch Fall 24.↩